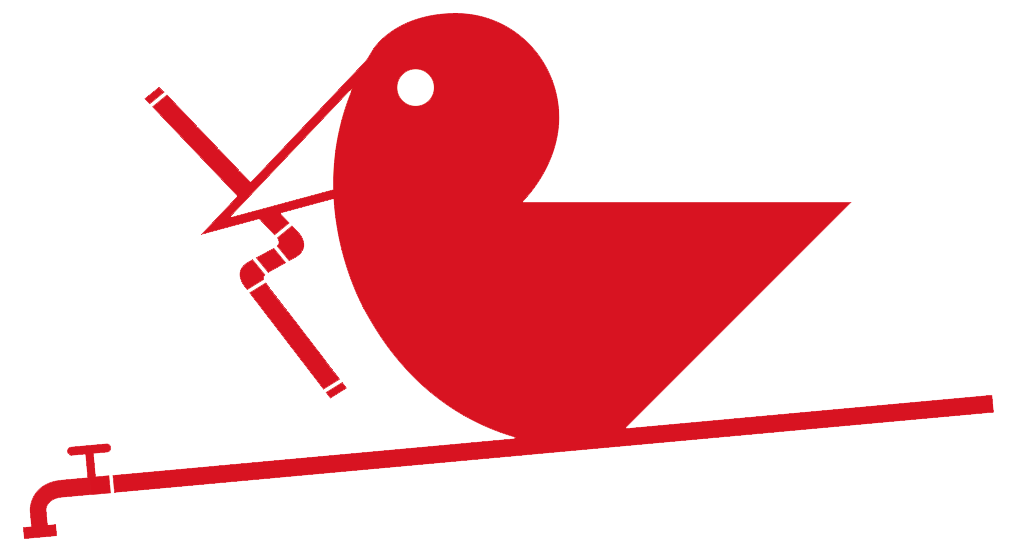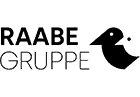Warmes, stehendes Wasser ist eine ideale Brutstätte für krankmachende Bakterien. Vor allem die Legionellen haben sich einen Ruf als potenzielle Killer erworben, denn immer wieder gibt es größere Ausbrüche der Legionärskrankheit mit Todesopfern. Weniger bekannt ist, dass die meisten Erreger in den eigenen vier Wänden zuschlagen. Wie das kommt und was man dagegen tun kann.
Legionellen sind eine ganze Gattung von Bakterien, von denen nicht alle Arten gleich gefährlich sind. Die gesundheitlich relevanten Stämme lösen zwei Krankheiten aus: zum einen die von Lungenentzündungen begleitete Legionärskrankheit, zum anderen das Pontiac-Fieber, das wesentlich milder verläuft. Die Infektion erfolgt über Aerosole, also Tröpfchen, die in der Luft schweben und eingeatmet werden. Aerosole entstehen zum Beispiel unter Duschen, in Whirlpools, Vernebelungs- und Klimaanlagen, teils bei der Autowäsche, in besonders großer Menge übrigens in Kühltürmen.
Am gefährlichsten sind Legionellen im Duschkopf
Weil sich Menschen untereinander nicht anstecken können, sind viele spektakuläre Ausbrüche auf schlecht installierte oder gewartete sanitäre Anlagen zurückzuführen – in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hotels, Kraftwerken oder Fabriken. Einer aktuellen Studie zufolge sind aber Fälle in privaten Haushalten in der Summe noch häufiger. Sie werden nur oft nicht erkannt. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass auf 600 gemeldete Fälle im Jahr 20.000 bis 30.000 unerkannte Erkrankungen kommen. Gefährdet sind vor allem ältere Menschen und solche mit einer Immunschwäche.
Die Bakterien lieben stehendes, zwischen 25 und 45 Grad warmes Wasser. Und das findet sich eben auch in Leitungen, Kesseln, Wärmepumpen, Warmwasserbereitern oder Filtern von Eigenheimen und Mietshäusern – besonders wenn sich dort Biofilme gebildet haben. Zu einer Übertragung kommt es dann am häufigsten beim Duschen, wenn das dort zerstäubte Wasser eingeatmet wird.
Eine Druckspülung beseitigt Legionellen und ihre Nahrungsquellen
Freie, saubere Leitungen, regelmäßig fließendes kühles Frischwasser (unter 25 Grad) und heißes Warmwasser über 55 Grad) verhindern Legionellen zuverlässig. Hilfreich sind Thermen und Durchlauferhitzer, die Warmwasser erst kurz vor der Entnahme aufheizen. Risiken ergeben sich dagegen, wenn Kalt- und Warmwasserleitungen mangelhaft isoliert sind und nah beieinander liegen, wenn Warmwasser in Kesseln gespeichert wird oder lange in Leitungen steht.
Manche Anlagen haben eine so genannte Legionellenschaltung: Dann wird der Vorlauf regelmäßig auf über 70 Grad erhitzt, was Bakterien schnell abtötet. Wärmepumpen und Kessel können mit einem Heizstab ausgerüstet werden, der auch tieferliegendes, weniger heißes Wasser erreicht. Eine Erhitzung bei Befall ist ebenfalls wirksam – aber oft nur kurzfristig. Denn in Leitungen setzt sich häufig ein Biofilm ab. Dieser haftet an Rost- und Kalkablagerungen und bietet den Bakterien einen idealen Nährboden. Um diesen aus den Leitungen zu bekommen, hilft eine Druckspülung.
Wie der Spülkompressor eingesetzt wird
Als Fachbetrieb setzen wir dafür einen eigenen Spülkompressor ein, der sowohl mit Trinkwasser als auch mit einem Luft-Wasser-Gemisch arbeiten kann. Der Druck beträgt in der Regel 8 Bar, also ein Bar über Wasserdruck – und entfernt so Rückstände, an die sich Biofilme anlagern können. Wichtig ist natürlich, dass alle Leitungsabschnitte erreicht werden.
So gehen wir bei der Leitungsspülung vor:
- Wir entfernen zunächst alle sensiblen Geräte.
- Dann werden alle Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) abgesperrt.
- Die Leitungen werden mit Trinkwasser gefüllt und entlüftet.
- Dann wird gespült: 15 Sekunden pro Meter Leitung ist Minimum.
- Nach jedem Abschnitt nehmen wir uns den nächsten vor – von der Quelle an.
- Zum Schluss spülen wir mindestens zwei Minuten jede Entnahmestelle.
Danach ist Ruhe und das Wasser kann ohne Bedenken genutzt werden. Ein Tipp: Wenn Sie in einem Mietshaus wohnen, ist es Pflicht des Vermieters, regelmäßig die Belastung mit Legionellen zu überprüfen. Hinweise auf erhöhtes Risiko sind überlange Leitungswege und ein mangelnder hydraulischer Abgleich.
Bildquelle: Pixabay